Der Sternhimmel im Dezember
Dr. Cecilia Scorza de Appl und Dr. Andreas Korn
Himmelsüberblick
Die Herbststernbilder und das Pegasusquadrat erscheinen nun gegen 19 Uhr
im Westhimmel. Eine Ausnahme bleibt Perseus, der seinen Platz um den
Zenit behält.
Die erste Wintersternbilder, Fuhrmann und Stier, sind über dem
Osthorizont zu sehen. Bis Mitternacht folgen dann der Jäger
Orion mit seinen Jagdhunden, der Große und der Kleine Hund, und
das Sternbild Zwillinge. Das Wintersechseck, bestehend aus den hellen
Sternen Capella im Fuhrmann, Aldebaran im Stier, Rigel im Orion,
Sirius im Großen Hund, Prokyon im Kleinen Hund und Pollux im
Sternbild Zwillinge, strahlt in seinem vollen Glanz. Der hellste
Stern am Nachthimmel überhaupt ist jetzt zu sehen: Sirius
(griech. seírios = der Flammende, heiss), das Auge des Großen
Hundes. Dieser Stern hat ein strahlend helles, bläulich-weißes
Licht, das so hell erscheint, weil er mit 8,6 Lichtjahren (81
Billionen km!) Entfernung relativ nahe an uns steht.
Das Sternbild Orion in Kulturvergleich
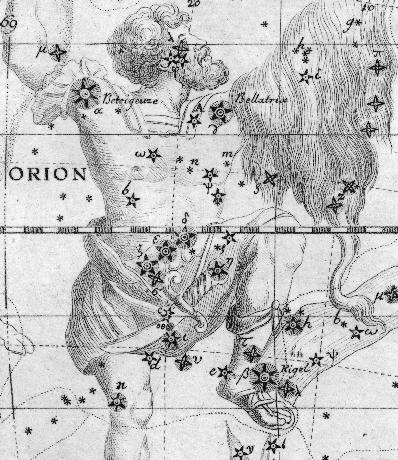 Der Name dieses Sternbildes bezieht sich auf den großen
griechischen Jäger Orion,
der einmal sich damit gebrüstet haben soll, der beste Jäger
der Welt zu sein und alle wilde Tiere der Erde töten zu können.
Dies wurde ihm von Gaia, die Erdgöttin, verübelt. So
schickte sie einen Skorpion aus, der Orion einen tödlichen Stich
zufügt. Zeus versetzt daraufhin beide an den Himmel. Wenn das
Sternbild Skorpion
im Osten in Sommer aufgeht, muss Orion den Himmel im Westen
verlassen. Dadurch stehen die beiden Rivalen niemals zusammen am Himmel!
Der Name dieses Sternbildes bezieht sich auf den großen
griechischen Jäger Orion,
der einmal sich damit gebrüstet haben soll, der beste Jäger
der Welt zu sein und alle wilde Tiere der Erde töten zu können.
Dies wurde ihm von Gaia, die Erdgöttin, verübelt. So
schickte sie einen Skorpion aus, der Orion einen tödlichen Stich
zufügt. Zeus versetzt daraufhin beide an den Himmel. Wenn das
Sternbild Skorpion
im Osten in Sommer aufgeht, muss Orion den Himmel im Westen
verlassen. Dadurch stehen die beiden Rivalen niemals zusammen am Himmel!
Wir wissen mit Sicherheit, dass der Name des Sternbilds älter als
die griechische Mythologie ist. So zeigen jüngste
Untersuchungen, dass der Name sich vom Akkadischen
Uru-anna,"Licht des Himmels" leitet, der die
Griechen später übernommen haben. Die Sumerer
sahen darin ein Schaf.
Und so war sein hellster Stern Beteigeuze, der aus dem
Arabischen
mit »Achsel« übersetzt wird, die »Achsel
des Schafs«.Beteigeuze
ist einer der 20 hellsten Sterne am Himmel. Sie ist ein rote
Variabelstern, deren Durchmesser während seiner Pulsationen
zwischen dem 300- und 400-fachen des Durchmessers unserer Sonne
schwankt. Im alten China
ist Orion eines der 28
chinesischen Tierzeichen .
Er wird als Shen bezeichnet,
was »drei« bedeutet und wahrscheinlich von den
drei Gürtelsternen herrührt. Die Ägyptern sahen in
Orion eine Widerspiegelung ihres GottesOsiris
und die Wikingern den Gott Thor, der durch einen Fluss watet und den
Gott Loki
an seinem Gürtel hängend hinüber zieht. Aufgrund
seiner Auffälligkeit es ist nicht erstaunlich, dass viele Völker
dem Sternbild verschiedenste Bedeutungen zugeschrieben haben.
Sonne, Mond und Planeten
Da die Sonne am 21. Dezember den südlichsten Punkt ihrer
scheinbaren Jahresbahn durchläuft (Wintersonnenwende,
astronomischer Winteranfang), steigt die tägliche
Sonnenscheindauer auf der Nordhalbkugel ab dem 22. wieder an, die
"Tage werden länger".
Die Neumondphase wird am Monatsersten erreicht, Vollmond entsprechend am
15. Dezember.
Merkur erreicht am 12. seine größte (westliche) Winkeldistanz zur
Sonne und ist demnach kurz vor Sonnenaufgang im Südosten zu
sehen. Beste Gelegenheit den flinken Götterboten zu erspähen
bieten sich zwischen dem 7. und 17., jeweils um 7 Uhr. Venus
ist weiterhin Abend-„Stern“. Am Monatsanfang ist sie bis etwa 19
Uhr im Südwesten zu sehen, am Monatsende bestenfalls bis 18 Uhr.
Mars ist weiterhin ein
auffälliges Objekt am Abendhimmel, vom Morgenhimmel zieht er
sich zunehmend zurück. Zu Silvester verschwindet er bereit um 3
Uhr früh in den horizontnahen Dunstschichten. Jupiter
übernimmt die morgendliche Himmelsbühne vom Mars. Ab 5 Uhr
kann man ihn im Osten sehen. Saturn
nähert sich der Gegenscheinphase (Opposition zur Sonne) und ist
somit fast die ganze Nacht sichtbar. Er steht zwischen Regulus im
Löwen und den Zwillingssternen Castor und Pollux. Uranus
kann noch in den Abendstunden aufgefunden werden, Neptun
und Pluto sind derzeit nicht sichtbar.
Der Stern von Bethlehem als Konjunktion zweier Planeten
Was war der Stern von Bethlehem? Gab es er wirklich? Jahrhunderte haben
Astronomen und Astrologen nach der Antwort dieser Frage gesucht. Noch
heute gibt es den Versuch, biblische Beschreibungen mit dem von alten
Völkern registrierte Himmelsereignisse zusammenzubringen um die
Lösung zu finden. Der Stern als Kometen zu deuten war eine erste
Idee, die keine astronomische Unterstützung fand: es wurde kein
Komet in der römische Zeit besichtigt. Darüber galten
Kometen eher als Unheilboten als Ankündiger von Königen.
Auch wurde in der Zeit keine Supernova Explosion beobachtet. Die
jüngste Theorie hat der Astronom Michael R. Molnar in das Buch
"The Star of Bethlehem: The Legacy of the Magi" zusammengefasst.
Nach einer ausführlichen Untersuchung von Münzenmotiven der
Herodeszeit, Schriftquellen und astronomische Ereignisse (die sich
Anhang von Computer reproduzieren lassen), kommt er zu den
Entschluss, dass Jesus am 17 April, 6 v. Chr., zwei Jahre vor dem Tod
Herodes, geboren wurde. Am den Tag erschien Jupiter im Osten als
Morgenstern in Konjunktion mit Saturn (von der Erde aus gesehen,
hinter einander) und der Mond im Zeichen Widder. Sehr wahrscheinlich
konnte man beide Planeten mit bloßem Auge nicht trennen.
Jupiter und Saturn sind schon alleine sehr helle Objekte; wenn sie
zusammen an der gleichen Stelle stehen, ergibt sich ein sehr heller
neuer "Stern". Der österreichische
Astronom d´Occhieppo entdeckte im British Museum Keilschriften
von babylonischen Priestern, die das astronomische Ereignis 6 v. Chr.
beschreiben.
Nun, das Tier Widder ist ein Symbol des judischen Volkes, das immer wieder
im Alttestament erwähnt wird. Deswegen zogen die drei weisen
Priester (Könige) nach Israel. Das die Geburt Christi "6
v.Chr" geschah kann man wie folgt erklären: Unsere
Jahreszählung geht auf den römischen Mönch Dionysus
Exiguus zurück, der sich bei seinen Rückrechnungen 6 Jahren
geirrt hat. Somit passen nach Molnar die historischen Eckdaten und
das Treffen der Planeten Jupiter und Saturn im Widder überrein.
Warum wir Christisgeburt am 24. Dezember feiern liegt daran, dass die
frühen Christen den genauen Geburtstag nicht kannten und einen
heidnischen Feiertag "der Geburt des Sol Invictus", der
unbesiegbaren Sonne, adoptiert haben.
SAP Unterstützung für die Astronomieschule e.V.: Dank der
Unterstützung von SAP im Rahmen des Regionalen Engagement
Projekts, werden wir ab Dezember 2005 in der Lage sein, eine
große Anzahl unserer Workshops und Lehrerberatungen an Schulen
und Lehrer kostenlos anzubieten. Weitere Information unter HD 21681
(nur abends) oder cecilia.appl@abenteuer-astronomie.de.
Eine Einführung in die Himmelsorientierung für Familien bietet
Frau Scorza de Appl am Sonntag, den 11.12.05 um 15:30 Uhr im EXPLO
Heidelberg an (Technologiepark, im Neuenheimer Feld, Gebäude
582). Die Veranstaltung wird durch didaktische Spiele, eine
Jahreszeitenstation und das Basteln einer drehbaren Sternkarte für
die Himmelsorientierung begleitet.
Führungen: Die Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl bietet
regelmäßige Führungen an, bei denen, gutes Wetter
vorausgesetzt, Beobachtungen am Fernrohr durchgeführt werden.
Näheres unter 06221-541706 (zwischen 12:00 und 16:00 Uhr) oder
unter http://www.lsw.uni-heidelberg.de
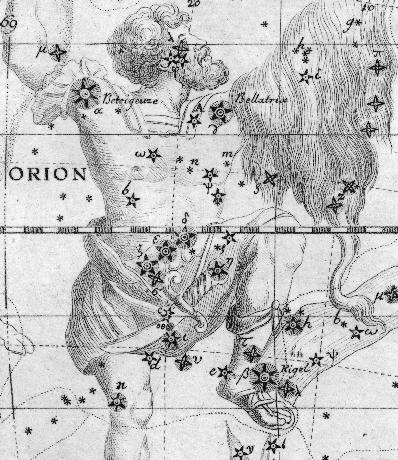 Der Name dieses Sternbildes bezieht sich auf den großen
griechischen Jäger Orion,
der einmal sich damit gebrüstet haben soll, der beste Jäger
der Welt zu sein und alle wilde Tiere der Erde töten zu können.
Dies wurde ihm von Gaia, die Erdgöttin, verübelt. So
schickte sie einen Skorpion aus, der Orion einen tödlichen Stich
zufügt. Zeus versetzt daraufhin beide an den Himmel. Wenn das
Sternbild Skorpion
im Osten in Sommer aufgeht, muss Orion den Himmel im Westen
verlassen. Dadurch stehen die beiden Rivalen niemals zusammen am Himmel!
Der Name dieses Sternbildes bezieht sich auf den großen
griechischen Jäger Orion,
der einmal sich damit gebrüstet haben soll, der beste Jäger
der Welt zu sein und alle wilde Tiere der Erde töten zu können.
Dies wurde ihm von Gaia, die Erdgöttin, verübelt. So
schickte sie einen Skorpion aus, der Orion einen tödlichen Stich
zufügt. Zeus versetzt daraufhin beide an den Himmel. Wenn das
Sternbild Skorpion
im Osten in Sommer aufgeht, muss Orion den Himmel im Westen
verlassen. Dadurch stehen die beiden Rivalen niemals zusammen am Himmel!